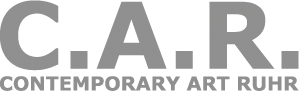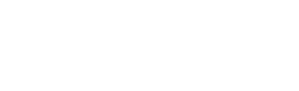Aus dem Programm
Stand: 26.2.2024
C.A.R. Video-Lounge, Halle 12, 1. OG/ Foyer, FR-SO zu den Öffnungsgszeiten der PHOTO/MEDIA ART FAIR, mit: Nick Jordan, Rastko Novakovic, Eva Rudlinger, Ruxandra Mitache, Steven Ball, Terry Flaxton, Anna Mortimer, Alex Pearl, Emily Richardson, Lynn Loo, Bea Haut, Nicky Hamlyn, Stuart Pound and Rosemary Norman, Philip Sanderson, Kerry Baldry, My Name is Scot, Andrew Vallance, Bob Georgeson, Julia Dogra-Brazell, Katharine Meynell, Tony Hill, Gordon Dawson, Michael Szpakowski & Anna Szpakowska, Robert Sherwood Duffield, Louisa Minkin & Alex Schady, Zhel (Zeliko Vukicevic), Jonathan Moss, Guy Sherwin, Rachael Allain, Jacob Cartwright, Kayla Parker & Stuart Moore, Leister/Harris, Paul Tarrago, Jenny Baines, Jamie Naqvi, Guido Devadder, Hendrik van Oordt, Debjit Bagchi, Daniela Lucato